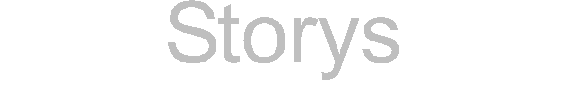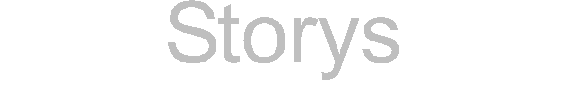|
|
|
|
|
|
Tennis in Deutschland: Tennisexperten zur Lage und was getan werden müsste.
Kein Grund zu jammern
Schwarz sehen und zu jammern ist falsch. „Lasst uns doch alle", so Ex-Wimbledonsieger Michael Stich, „positiv nach vorn blicken, denn Tennis ist eine der tollsten Sportarten, die zweitbeliebteste bei Jugendlichen und im Deutschen Sportbund der drittstärkste Verband."
Und wirklich: Es gibt hierzulande wieder Erfreuliches im Tennis. Der junge Florian Maier kam in Wimbledon ins Viertelfinale und hat sich von den Top-300 unter die Top-50 hochgearbeitet. Tommy Haas gewann die Turniere in Houston und Los Angeles. Rainer Schüttler stand zweimal und Nicolas Kiefer viermal in einem Endspiel, und zusammen haben sie in Athen die Olympische Silbermedaille im Doppel gewonnen. Deutschland ist mit den Jugendlichen eine dominierende Nation. Das Rasenturnier in Halle oder der World-Team-Cup in Düsseldorf sind nach wie profitabel. Auch strömten die Tennisfans in Hamburg, Halle, Berlin, München und Stuttgart zu den Turnieren, und die Zuschauerzahlen lagen über den Vorjahren.
Natürlich waren wir anderes gewohnt. Zu Zeiten von Steffi Graf, Boris Becker & Co. Die haben eine Tennis-Euphorie ausgelöst, die einmalig war und an der wir nun zu knabbern haben. Zum einen, weil Tennis im Fernsehen nicht mehr der große Hit ist - da müsste erst einmal wieder eine(r) bei den Grand Slam-Turnieren etwas Großartiges reißen oder ein deutsches Team den Davis Cup holen. Zum andern, weil die Sponsoren den Turnierveranstaltern nicht mehr die Bude einrennen, und „der internationale Tennismarkt", so Ralf Weber, der Turnierdirektor von Halle, „hart umkämpft ist."
Aber das hat auch andere Gründe. Wirtschaftlicher Art, sagt der DTB-Damentrainer Klaus Eberhard. Es sei nicht ein Problem der Sportart Tennis sondern der Industrie des Landes, Europas und der Welt. Dass es mit Tennis nicht mehr so rosig läuft wie vor ein paar Jahren, spüren fast alle Turniere in Europa und Amerika. Auch die Spieler/innen-Organisationen ATP und WTA, die die Preisgeldinflation angeheizt und den überladenen Turnierkalender verschuldet haben.
Wie nun sehen Tennisexperten die Lage, was schlagen sie vor, um Schwachpunkte des Systems auszumerzen und dem Tennis in Deutschland weiteren Auftrieb zu geben? Zum Beispiel beim Nachwuchs. -- Dazu Klaus Eberhard, der Fed Cup-Teamchef: „Neben einer individuellen Betreuung oder Betreuung in kleinen Gruppen ist der absolute Wille des Spielers im Alter zwischen 17 und 21 Jahren ganz entscheidend. Wir können die Spieler nicht zu 100-prozentigem Einsatz zwingen, wir können mit unseren Möglichkeiten nur versuchen, ihnen zu helfen, das Beste aus sich herauszuholen. Wie es geht, hat Florian Mayer vorgemacht. Der war unter den zehn besten Jugendlichen, hat dann die Verantwortung selbst übernommen und zwei Jahre intensiv mit seinem Trainer gearbeitet und so den Übergang zu den Profis geschafft. So sollte es bei Philipp Kohlschreiber auch sein und bei 2, 3 anderen hätte es so sein können. Dass es nicht so ist, liegt an deren Einstellung, was sie auch selbst zugeben. Mehr Geld wäre schön und würde uns weiter helfen, aber daran allein liegt es nicht."
Michael Stich sieht das ähnlich und meint: „Nichts ist wichtiger, als die Vereine mit ihren kreativen Aufgaben als Basis. Wenn aus einigen Talenten nichts wird, liegt es nicht an der Förderung, nicht den Eltern, dem Umfeld, es liegt an zu wenig motivierten Jugendlichen, die sich nicht richtig quälen wollen. Einen Jugendlichen, der keine Bereitschaft hat, sein Talent auszubauen, würde ich rausschmeißen." Ulf Fischer glaubt, dass der absolute Wille seines Schützlings Florian Mayer für dessen Erfolge entscheidend ist. „Florian wurde Profi", sagt Fischer, „weil er das mit Leib und Seele gewollt hat. Man muss, wie Florian,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tennis lieben, eiserne Disziplin aufbringen, andere Interessen zurückstecken und sich der Sache total verschreiben."
„Erfolg ist nicht zufällig", sagt auch Boris Becker, „ich habe in jungen Jahren vom DTB profitiert und mit Boris Breskvar einen hervorragenden Trainer im Leistungszentrum in Leimen gehabt. Als ich 17 Jahre alt war, hat mich allerdings Tiriac aus dem DTB herausgeholt." Becker bemängelt vor allem, dass es keinen guten Übergang aus dem Jugendbereich gibt und meint: „Wir wursteln in den Verbänden und Zentren vor uns hin und danach werden die Spieler wie heiße Kartoffeln fallen gelassen. Ich glaube, wir haben ein Trainerproblem."
Das Problem ist seit langem bekannt. Deshalb sagte auch Walter Knapper, der Turnierdirektor in Hamburg: Jungen Spieler müssen frühzeitig an die Profitour herangeführt werden. Wir brauchen ein zentrales Konzept mit den Landesleistungszentren als dezentrale Basis." Aber läuft es so? -- „Es werden noch immer Millionen im Jahr", so Frank Hofen, der Presseleiter bei den Gerry Weber Open, „mit einem dezentralen System für den Spitzensport ausgegeben und die Schwächen des Verbandes ausgenutzt. So können wir in Zukunft nicht weiter machen. „
So weiter machen wollte auch Michael Stich nicht. „Meine Vorschläge lagen auf dem Tisch, aber unter den alten Strukturen weiterzuarbeiten, machte keinen Sinn." Das sieht auch Ex-Profi Bernd Karbacher so: „Wir brauchen Strukturänderungen. Jeder Verband hat ein eigenes Leistungszentrum und gibt Talente nicht her oder erst viel zu spät, und meine Dienste und die von erfahrenen Ex-Spielern sind in Deutschland nicht wie in anderen Ländern gefragt."
„Tennissportliche Spitzenleistung", sagt der Diplomsport- und Tennis-Lehrer Wolfram Schmidle, „sind in der Regel individuelle Zufallsprodukte. Dass es auch anders geht, zeigen Tennis-Team-Systeme in Spanien, Argentinien, Schweden, Frankreich, wo der direkte Konkurrenzkampf die Spieler weiterbringt. Ein professionelles Umfeld sowie Wettkämpfe in frühem Alter sind Voraussetzungen für große, leistungssportliche Erfolge."
Nachwuchs- und Sportförderung hängt aber auch ab vom Geld. „Um intern im Sport in Deutschland gute Rahmenbedingungen zu schaffen", sagt Prof. Josef Hackforth von der TU München, „brauchen wir extern finanzstarke Förderer und Sponsoren. Auf das Konzept kommt es an, dann findet man Partner. Ich schätze das Ehrenamt. Aber am Punkt, wo es um Professionalität, Geld und Partner geht, da braucht man professionelle Leute." Ohne Einschnitte an den Strukturen funktioniert das nicht. „Mit dem Geld geben ist es aber nicht getan", so Burghard Graf Vizthum von Daimler-Chrysler, einem Hauptsponsoren im Tennis, „man muss sich dann auch persönlich für die Sache engagieren."
Volker Kottkamp, ARD-Tenniskommentator, führt noch andere Gesichtspunkte an. „Man braucht im Sport Erfolg in Deutschland, sonst bewegt sich nichts. Der Spitzensport macht mir Sorgen, weil der Auswirkungen auf den Breitensport hat. Plötzlich stehen in den Clubs Tennisplätze leer. Auch die nationale Komponente ist wichtig. Die Spieler begreifen erst jetzt die Bedeutung und Chancen des Davis Cups, denn da kann man Begeisterung entfachen wie in anderen Ländern."
„Man kann, wenn man Spitze sein will im Sport", so Stuttgarts Oberbürgermeister Wolfgang Schuster, „im internationalen Wettbewerb nur vorn sein, wenn alle Kräfte auf nationaler Ebene gebündelt werden." Es geht aber nicht nur um den Spitzensport, zumal wie Prof. Hackforth meint: „Tennis in Deutschland ein Potential für 4,5 Millionen hat, doch davon nicht mal die Hälfte genutzt wird." Gute Aussichten, aber nur, wenn eine professionell geführte DTB-Spitze aktiv wird, damit Hackforth den Verantwortlichen nicht weiter vorwerfen kann, es werde zu viel geredet, ohne dass Taten folgen.
Eberhard Pino Mueller
publiziert: September 2004
DTZ Deutsche Tennis Zeitung
Tennisbibliothek: TAKEOFF-PRESS
Presse-Dienst-Süd - JOURNAL/EURO
|
|
|
|
|
|