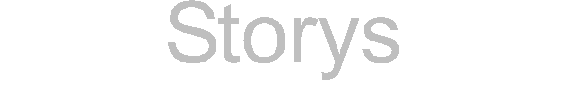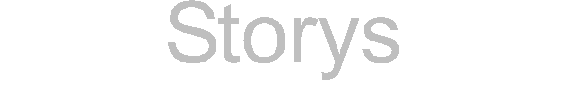|
|
|
|
|
|
Tenniscoach - Antreiber, Inspirator, Analytiker, Taktiker, Selentröster, Psychologe, Handtuchhalter, Beschützer. Wer, mit wem - und warum
Trainer, Tennis und der Hinterkopf
Was für ein Witz! Nick Bollettieri ist weltweit der bekannteste Tenniscoach. Zehn seiner Schüler wurden die Nummer eins der Welt und unzählige machten unter seinen Fittichen große Tenniskarrieren, dabei hat der Mann selbst nie richtig Tennis spielen gelernt.
Tennis ist eben ein verrücktes Spiel. Jedenfalls auch für Maria Sharapova, die über ihr Tennis sagt: „Du hast einen Griff in der Hand, Saiten an dem Schläger und einen simplen, gelben Ball, und du machst, seitdem du vier bist, nichts anderes, als diesen Ball zu schlagen - es ist zum Lachen, wirklich verrückt, aber es ist das, was wir tun." Die russische Bollettierischülerin, die von ihrem Vater Yuri Sharapov und Michael Joyce gecoacht wird, darf sich aber nicht beklagen, denn jährlich springen dabei Millionen in zweistelliger Höhe heraus.
Kein Wunder, dass es überall auf der Welt Eltern gibt, die Tennisstars aus ihren Kindern machen wollen. Es ist aber ein langer und mühsamer Weg bis zur Spitze und niemand schafft es allein. Nicht mit viel Talent und nicht mit harter Arbeit. „Tennis", sagt der Ex-Tennisprofi und neuseeländische Verbandscoach Lane Bale, der auch einmal die BMW Open im Doppel gewonnen hatte, „Tennis ist einfach, das heißt aber nicht, dass es einfach ist, denn die Spieler machen Tennis kompliziert für sich selbst." Das Dumme ist - viele, selbst Topspieler, merken dies nicht und kommen nicht weiter oder sacken sogar ab. Spätestens dann ist ein guter Coach gefragt.
Auch Philipp Kohlschreiber ist an einem Punkt, wo er mit seinem Potenzial mehr herausholen muss. „Ich will weiterkommen, muss mich steigern - mir ging die Spannung verloren", sagte er bei den US Open in New York. Deshalb die Trennung von seinen Trainern und der bayrischen TennisBase. Kein einfacher Schritt, aber schwerer wäre, „wenn ich mich von meiner Freundin trennen müsste."
Jetzt wird Andy Murrays Ex-Trainer Miles MacLagan mit ihm zusammenarbeiten, erst einmal auf Probe, das sei gang und gäbe, denn „die Chemie zwischen uns muss stimmen." Verständlich, denn Kohlschreiber sagt offen: „Ich habe einen eigenen Kopf." Vom Gefühl her, passe es, denn beide haben das Ziel, „mich in die Top 20 zu bringen." Eine solide Basis zum Arbeiten sei da, habe MacLagan gemeint, aber auch gesagt, er sei kein Zauberer, nur ein Trainer mit Ehrgeiz. Kein schlechter Griff, meint denn auch Patrik Kühnen, der deutsche Davis-Cup-Kapitän. MacLagan sei ein cooler Typ und menschlich passten er und Kohlschreiber auch gut zusammen.
Keine einfache Sache, so ein Verhältnis zwischen Trainer und Spieler. Der Australier Fred Stolle, eine Tennislegende mit 18 Grand-Slam-Titeln, sagt: „Der Spieler ist der Boss und hat das Sagen. Der Spieler muss den Coach aber respektieren, ihm vertrauen und ihm zuhören. Der Trainer muss für den Spieler da sein, wenn er ihn braucht, muss ihm taktische Anweisungen geben, auf gute Kondition achten, Ärger vom Hals halten, ihn beraten und ihm helfen." Dirk Hordorff, der langjährige Coach von Rainer Schüttler, formuliert die Aufgabe eines Trainers kurz und treffend so: „Er muss den Spieler besser und erfolgreicher machen."
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die Frage ist aber immer: wie? Zum einen, weil jeder Spieler anders ist und jeder Trainer im Hinterkopf eigene Vorstellungen hat. Lennart Bergelin, der väterliche Langzeitcoach von Björn Borg, wurde einmal gefragt, warum er Borg keinen Volley beigebracht habe. Bergelins Antwort: „Warum sollte ich? Wenn ich ihn von der Grundlinie weghole, hole ich ihn da weg, wo er am stärksten ist."
Eine der wichtigsten Aufgaben eines Trainers ist es, herauszufinden, was gut ist für den Spieler und was nicht. Und er muss ein Wohlfühl-Umfeld schaffen. Das erklärt auch, warum Rainer Schüttler mit Dirk Hordorff, Mikhail Youzhny mit Boris Sobkin seit seinem zehnten Lebensjahr, Gustavo Kuerten mit Larri Passos seit seinem zwölften Lebensjahr, Stefan Edberg mit Tony Picard, Rafael Nadal mit seinem Onkel Toni Nadal, Andre Agassi mit Brad Gilbert oder Ronald Leitgeb mit Thomas Muster so langjährige Spieler-Coach-Beziehungen hatten oder haben. „Ein guter Spieler ist von sich aus motiviert", sagt „Ronnie" Leitgeb, „ich muss ihn aber inspirieren, dass er sein Potenzial voll ausschöpft und wie Thomas (Muster) das Beste nach und nach aus seiner Veranlagung macht."
Das will auch Andrea Petkovic, die über sich sagt: „Ich bin 22 aber als Tennisspielerin erst 17. Ich steh' oft da und frag' mich, was mach' ich da." Sie meint damit, dass ihre Konkurrentinnen mit Tennis viel früher richtig angefangen hätten und sie in ihrer Entwicklung noch viel Nachholbedarf habe. Ihr Handicap ist, dass ihr Vater Zoran als ihr Coach nur selten auf Turnierreisen dabei sein kann, da er eine Tennisschule betreibt. Doch diesmal, zu den US Open, kam er mit. Und dann war auch noch Petar Popovic, der Coach des verletzten Ivo Karlovic, für sie da. Ein Glücksfall. Andrea spielte mit soviel Unterstützung groß auf, servierte die Nummer 16 der Welt Nadia Petrova ab, dann, nach Abwehr von drei Matchbällen, die Amerikanerin Mattek-Sands und verlor, nachdem ihre nächste Gegnerin nicht angetreten war, erst unter den letzten Sechzehn gegen die spätere Finalistin Vera Zvonareva.
Mit der Erkenntnis, „ich brauche in jedem Fall auf dem Niveau, wo ich jetzt stehe, ein perfektes Umfeld und unterwegs einen festen, guten Coach", reiste sie aus New York ab. Mit dem Papa wird es wohl nicht gehen. „Der kann nicht immer und muss selbst arbeiten. Er will mich auch nicht unter Druck setzen, zu gewinnen, wenn er schon kein Geld verdient. Auch Petar Popovic kann nicht, der ist hier nur eingesprungen." Eine Möglichkeit ist vielleicht Glen Schaap, mit dem Andrea Petkovic Ende letzten Jahres in dessen Tennisakademie in der Schweiz zu trainieren begann, der da aber auch gebunden ist. „Ich muss jetzt klären, ob Glen vielleicht doch für mich Zeit hat, nachdem seine Akademie sich etabliert hat."
Auch wenn es viele Beispiele gibt, wo Väter oder Mütter ihre Kinder erfolgreich coachen, weil sie sie gut kennen - etwa Martina Hingis, Elena Dementieva, Jimmy Connors von ihren Müttern oder Sabine Lisicki, Maria Sharapova, Caroline Wozniacki, Agnieszka Radwanska, Yanina Wickmayer, Marion Bartoli, Monica Seles, Mischa Zverev von ihren Vätern - gibt es auch Problemfälle wie die Australierin Jelena Dokic oder die Französin Mary Pierce, die zuerst, von ihren Papas gut trainiert, Karriere machten, sich dann aber von ihren gewalttätigen Tennisvätern abwandten, weil die psychischen Belastungen unerträglich waren und bei Jelena Dokic sogar zu Depressionen geführt hatte.
Ein krasser Fall auch die junge Anna-Lena Grönefeld und
|
|
|
|
|
|