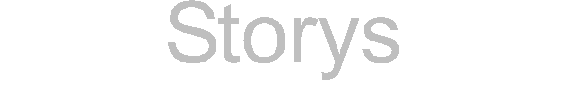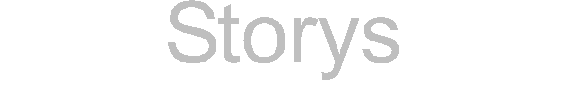|
Dopingfall der russischen Tennisspielerin Maria Scharapowa
Eine verzwickte Geschichte
Der Dopingfall von Maria Scharapowa war, nachdem die Russin ihre Strafe abgesessen hatte, noch keineswegs abgeschlossen, wie die Wildcard-Diskussion beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart und für die French Open in Paris gezeigt hat.
Aber zunächst einmal zum besseren Verständnis des komplizierten Falls: Was hat Maria Scharapowa gemacht? Sie hat über fast zehn Jahre ein Herzmedikament aus Lettland mit dem Wirkstoff Meldonium - angeblich gegen Diabetes - eingenommen. Meldonium beeinflusst den Sauerstoffbedarf der Herzmuskelzellen und versorgt dadurch den Körper mit mehr Energie. Nachdem sich bei Dopingtests zeigte, dass massenweise Leistungssportler Meldonium schluckten, wurde die Substanz wegen Steigerung der physischen und mentalen Belastungsfähigkeit von der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada endlich, ab Januar 2016, als Doping-Mittel eingestuft.
Wer Mittel seinem Körper zuführt, mit denen die Leistung auf unnatürliche Weise manipuliert wird, handelt gegen die allgemeinen Dopingbestimmungen. Maria Scharapowa hat das jahrelang straflos machen können und dabei bewusst die Chancengleichheit gegenüber ihren Mitspielerinnen zu ihren Gunsten beeinflusst.
Brenzlig wurde es für Maria Scharapowa aber erst, als sie bei den Australian Open im Januar 2016 erwischt wurde und zugab, dass sie das inzwischen verbotene Meldonium eingenommen habe. Sie hatte damals offensichtlich nicht gewusst, dass Meldonium im Körper nicht sofort abgebaut und ausgeschieden wird. Sie hätte sich sonst, wie viele der 2016 überführten Meldonium-Schlucker, listig herausreden und den positiven Doping-Befund auf Restbestände in ihrem Körper aus dem Vorjahr, als Meldonium noch nicht auf der Dopingliste stand, schieben können.
Was nach Scharapowas Einspuch beim Internationalen Sportgerichtshof CAS herauskam, war eigentlich ein Witz. Obwohl nach dem Wada-Anti-Doping-Code ein eindeutiger Dopingfall vorlag, wurde Scharapowas Meldonium-Missbrauch nicht nach den klaren, für alle geltenden Wada-Gesetzen gewertet, sondern lediglich als „grober Fehler", wofür die Strafe vom CAS gleich auch noch von 24 auf 15 Monate verkürzt wurde.
Diese unverständliche Argumentation, Scharapowa habe „nur" einen Fehler gemacht, war in gewisser Weise hilfreich für die Rechtfertigung, ihr eine Wildcard für die Hauptfelder der Tennisturniere in Stuttgart, Madrid und Rom zu geben. Markus Günthardt und Anke Huber, die Turnierverantwortlichen des Porsche Tennis Grand Prix, sprachen nicht von einer Dopingbetrügerin, sondern auch nur von einem schweren Fehler, für den Maria die Strafe abgesessen habe.
|
|