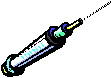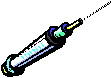|
Härtere Zeiten für Tennis-Dopingsünder
Der Kampf gegen Doping
Dumm gelaufen. Da wird Mariano Puerta beim Masters Cup in Shanghai während einer Pressekonferenz auf Dopinggerüchte angesprochen. Und was fällt dem Argentinier dazu nur mal eben ein: „Ihr Journalisten messt der Sache viel zu viel Bedeutung bei." Zwei Wochen später wurde Puerta als Doping-Wiederholungstäter für acht Jahre vom Tennis-Weltverband ITF gesperrt (Sperre wurde durch ein CAS-Urteil auf 2 Jahre reduziert).
Der unverbesserliche Puerta hatte sein Dopingproblem nicht gerade ernst genommen und gehofft, er käme mit einer kleinen Strafe davon - wie beim ersten Mal und wie fast alle Tennis-Dopingsünder in früheren Jahren. Doch er hatte sich getäuscht. Bereits 2005 hatte man gedopten Spielern richtige Strafen verpasst. Und in Zukunft kommen, wenn die ITF ihr Anti-Dopingprogramm im Einklang mit der Anti-Doping-Weltagentur WADA auch für die ATP Tour managen wird, noch härtere Zeiten auf Betrüger zu.
Während die ITF den WADA-Code wie fast alle großen Sportverbände sowie viele Regierungen schon vor Jahren unterschrieben hatte, mussten sich ATP und WTA daran nicht streng halten. So kam es zu Ungereimtheiten, wie etwa bei den 43 Nandrolon-Fällen zwischen August 2002 und Mai 2003, von denen sieben über den erlaubten Werten lagen. Die WADA bemängelte nach dem Freispruch aller Profis, die ATP missachte fundamentale Prinzipien der Dopingbekämpfung und habe als Organisation der Spieler zwangsläufig einen Interessenkonflikt. Und schon damals riet sie dazu, das Anti-Dopingprogramm der ITF zu überlassen.
Dass dem bisherigen Doping-Kontrollsystem nicht alle trauen, belegen auch Äußerungen einiger Tennisprofis, obgleich die meisten beim Thema Doping äußerst zurückhaltend sind. Leyton Hewitt etwa meinte: „Manchmal siehst du Jungs, die im fünften Satz fitter als im ersten sind." Und Roger Federer fragte: „Wie können andere Spieler nach Fünf-Satz-Kämpfen so schnell regenerieren? Das ist nicht normal. Wenn Urinkontrollen nicht ausreichen, muss endlich Blut untersucht werden." Auch Thomas Muster war sauer: „Man hat einen klaren Dopingfall (Korda), kriegt ihn nicht geregelt." Oder Nathalie Tauziat ist geschockt: „Man braucht keinen medizinischen Doktortitel, um zu sehen, wie Spielerinnen sich über Nacht verändert haben."
Aber kommen wir zur Sache - zu Fakten. Denn wer alle Dopingkontrollen übersteht, muss keineswegs sauber sein. Was nützen viele angesagte Wettkampfkontrollen, wenn man damit nur ein paar Dumme erwischen kann, die beim Doping Fehler gemacht haben? Anabole Steroide etwa, zum Muskelaufbau geschluckt, sind schon am nächsten Morgen oder nach wenigen Tagen nicht mehr nachweisbar. Ebenso Blutdoping, bei dem die erhöhte Leistungsfähigkeit, die beim immer athletischer werdenden Profitennis gefordert ist, jedoch über Wochen anhält.
So wurde denn auch von Eberhard Wenski, dem langjährigen Ex-Turnierdirektor der Ladies German Open in Berlin, bemängelt, die Dopingkontrollen im Tennis seien uneffektiv, nicht überraschend und ohne System. Und auch Bud Collins, der bekannteste, amerikanische Tennisjournalist, meint, ohne überraschende Kontrollen komme nicht viel heraus.
Anaboles Doping erfolgt im Training. Aber Trainingskontrollen stehen beim Anti-Dopingprogramm der internationalen Tennisverbände noch immer, obwohl sie immer erhöht werden sollten, kaum auf dem Plan. Die Begründung: Die Spieler hätten keine Auszeiten, weil Woche für Woche Turniere stattfinden. Auch wird von Eingriff in die Privatsphäre gesprochen. Venus Williams verbat sich Besuche von Dopingkontrolleuren grundsätzlich: „Ich lasse doch niemanden in mein Haus", und Jennifer Capriati wehrte sich gegen Blutkontrollen: „Keiner hat das Recht, in meinen Körper zu schauen."
Es fehlte in der Vergangenheit an einem offensiven Anti-Dopingkampf im Tennis. Leider auch oft am ernsthaften Willen bei der Aufklärung und Bestrafung der Fälle. Die sogenannten unabhängigen Schiedsgerichte hatten sich nur selten an den elementaren Grundsatz gehalten, dass der Athlet die Eigenverantwortung für Dopingmittel in seinem Körper trägt, und deshalb vor 2005 nur geringe oder gar keine Strafen verhängt. Das Absurde dabei: Spieler wie Greg Rusedski oder Bohdan Ulihrach verklagten die ATP, deren Schiedsgerichte sie zuvor gedeckt hatten, hinterher auf Schadenersatz.
Doch Besserung scheint in Sicht. Denn Ricci Bitti, der ITF-Präsident, will das Regelwerk der WADA im Tennis voll umsetzen. Auch nationale Anti-Dopingorganisationen passen inzwischen zusätzlich auf und machen den Tricksern das Leben schwerer. „Leider", so Ricci Bitti, „nicht in allen Ländern, doch in wenigen ist das eine sehr gute Sache." Etwa in Deutschland. Da werden die Tennisprofis von der nationalen Anti-Doping-Agentur NADA auch überraschend zu Hause oder beim Training kontrolliert.
publiziert: Juni 2006 DTZ-Deutsche Tennis Zeitung Eberhard Pino Mueller
Tennisbibliothek TAKEOFF-PRESS -- Presse-Dienst-Süd -- JOURNAL/EURO
Liste der veröffentlichten Dopingfälle im Tennis auf der nächsten Seite
|
|